Illustrationen: Sarah Eichert
Mein liebes Gewissen…
Norden. Da ist Hamburg. Die Elbe, der Hafen. Die Alster. Wir sind Hamburg. Und dort ist unsere Bar. Ein Ort des Rückzugs, ein Ort der Erfüllung. Der Raum der Stille neben der riesigen Fensterfront. Stille? Alles ist relativ. Die sanften Töne des Klaviers durchschneiden mich. Von wegen still. Engelsgleich scheinen Deine Finger über die Tasten zu schweben. Du spielst in Moll. Düster und traurig. Aber packend. Mitreißend. Du spielst wie eh und je und doch ganz anders. Du spielst es nicht, wie jeder es spielen würde, sondern so, wie Du es gerne spielst, wie Du es in diesem Moment spielen möchtest. Jetzt und so und nicht anders.
Hier sind wir: Das ist unsere Bar
Als ich das letzte Mal hier war, fragte ich mich, ob Deine Gefühle in Deine Finger fließen wenn Du spielst, ob nur sie Dich lenken. Ich fragte mich, ob Du wusstest, was Du gespielt hast und wie es klang und ob Du geahnt hast, an was ich dachte. Ich fragte mich, ob Du der warst, der Du zu sein behauptetest. Ich fragte mich, ob nicht alles nur ein Bild sei, ein Theaterstück der Wirklichkeit. Alles war wie immer, jetzt ist alles wie immer. Aber nichts ist, wie es scheint.
Wenn es nicht ist, wie es scheint, wie ist es dann? Bist Du denn gar nicht der, der Du durch Dein trauriges Lied zu sein behauptest?
Ich bleibe am Türrahmen stehen und lehne meinen Kopf an das kühle Holz. Ich wende den Blick nicht von Dir ab, blinzele nicht einmal. Ich frage mich, ob Du wohl merkst, dass ich da bin. Ich frage mich, ob in Deinem Kopf Alarmglocken läuten, die Dir zurufen: „Dreh dich nicht um und schau nicht. Dreh dich nicht um. Schau nicht.“
Klare Töne, in keinster Weise passend zum deprimierenden Moll.
Ich warte darauf, dass Du Dich verspielst. Dass Deine Finger daneben rutschen und eine Dur-Tonleiter herbeizaubern. Klare Töne, in keinster Weise passend zum deprimierenden Moll. Oder ist es nicht sogar teilweise Dur? Wieso passt es dennoch? Und wieso, frage ich mich, habe ich mich noch nie mit Deiner Musik auseinandergesetzt?
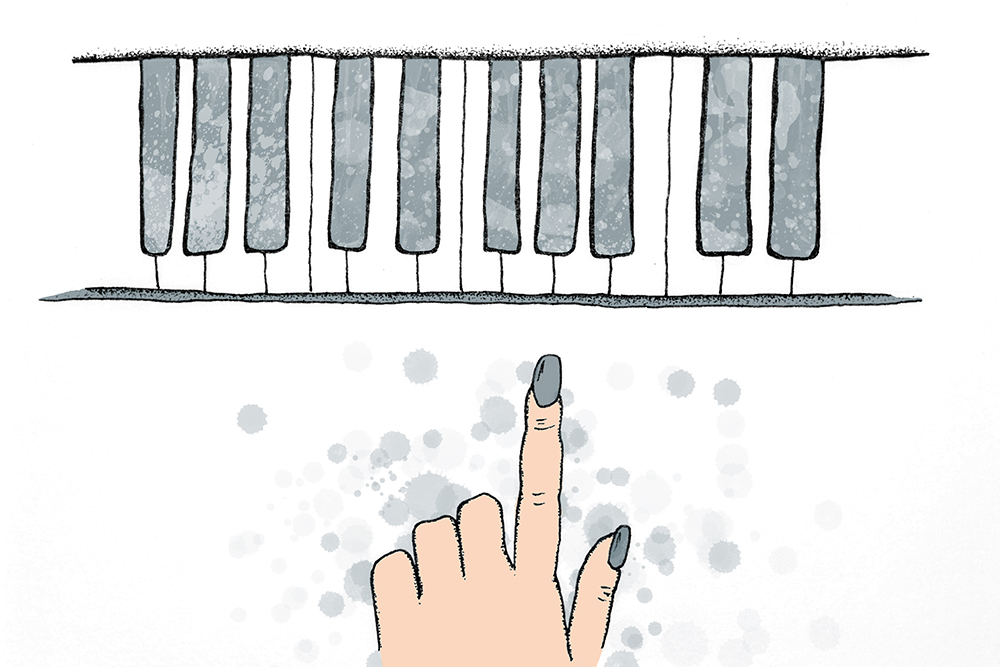
Doch deine Finger tun es nicht. Sie rutschen nicht ab. Bis zum Schluss spielst Du fehlerfrei. Dann drehst Du Dich um und siehst in meine Augen, siehst durch mich hindurch.
„Danke“, sagst Du. „Ich habe das Stück noch nie fehlerfrei gespielt.“
„Wie heißt es?“, frage ich, obwohl ich die Antwort schon kenne.
„Prélude. Rachmaninov. Aber das weißt du doch.“
„Ja.“ Mehr sage ich nicht.
„Frag nichts, was du nicht ohnehin schon weißt.“
Ich schweige. Wir beide schweigen uns an. Lange Minuten der Geräuschlosigkeit. Vielleicht Stunden. Aus den Augenwinkeln nehme ich die Flocken wahr, die sanft und leicht auf den Boden fallen, liegen bleiben. Ich kann das erste Mal verstehen, warum man den Raum so nennt, wie man ihn nennt. Raum der Stille. Raum der Einsamkeit. Selbst, wenn man nicht allein ist. Denn noch immer weiß ich nicht, ob Du wirklich der bist, der Du dort stehst, nun direkt vor mir. Oder in mir?
„Lass uns gehen“, sage ich irgendwann.
„Ja“, sagst du, aber rührst Dich nicht von der Stelle.
„Lass uns gehen!“, sage ich erneut, diesmal mit mehr Nachdruck in der Stimme.
„Ja?“ Ich weiß nicht, wo Du mit Deinen Gedanken bist, ich weiß nur, dass es ist nicht dort ist, wohin meine Gedanken mich gelenkt haben.
Ich ziehe Dich am Arm hinaus aus dem Zimmer, hinaus aus der der Bar. Ich merke, dass Du zitterst, und lege Dir meinen Mantel über die Schulter. Ich weiß nicht, wo Deiner ist, im Raum mit dem Klavier habe ich ihn nicht gesehen.
Die Alster – oder das, was davon übrig ist – ist in Dunkelheit getränkt. Das Eis muss inzwischen fest genug sein um einen Menschen tragen zu können. Eine leichte Schneedecke liegt darauf.
„Wollen wir es wagen?“, frage ich Dich und nicke in Richtung der Eisdecke. Eine einsame Ente kämpft sich zu der von Menschenhand geschaffenen Insel in der Mitte.
„Was wollen wir wagen?“, fragst Du. Du hältst den Kopf gesenkt. Kein Wunder, dass Du mich nicht verstanden hast.
„Das Eis“, sage ich. „Wollen wir über das Eis gehen?“ Erneut nicke ich in die Richtung und deute auch noch einmal mit dem Finger darauf. Die Ente kommt kaum voran, der Schnee geht ihr bis über die kleinen Füße aber er ist so weich, dass er sie nicht trägt.
„Sieh, da sind sogar Fußspuren“, lüge ich.
Langsam hebst Du den Kopf und siehst erst auf das Eis und dann auf mich. „Fußspuren?“
Ich ärgere mich, dass Du immer alles in Frage stellen musst.
Auf einmal wirst Du laut. „Da kann viel passieren! Wir könnten einbrechen und die Feuerwehr müsste uns retten. Oder nur du brichst ein und ich müsste mich in Lebensgefahr begeben, um dich zu retten. Das willst du doch nicht. Du willst doch nicht dafür verantwortlich sein, dass mir etwas passiert.“
„Okay. Wir gehen weiter.“ Ich will nicht mit Dir diskutieren. Kann es ja auch gar nicht. Weil Du kaum mal etwas sagst.
Du sagst, was Du willst
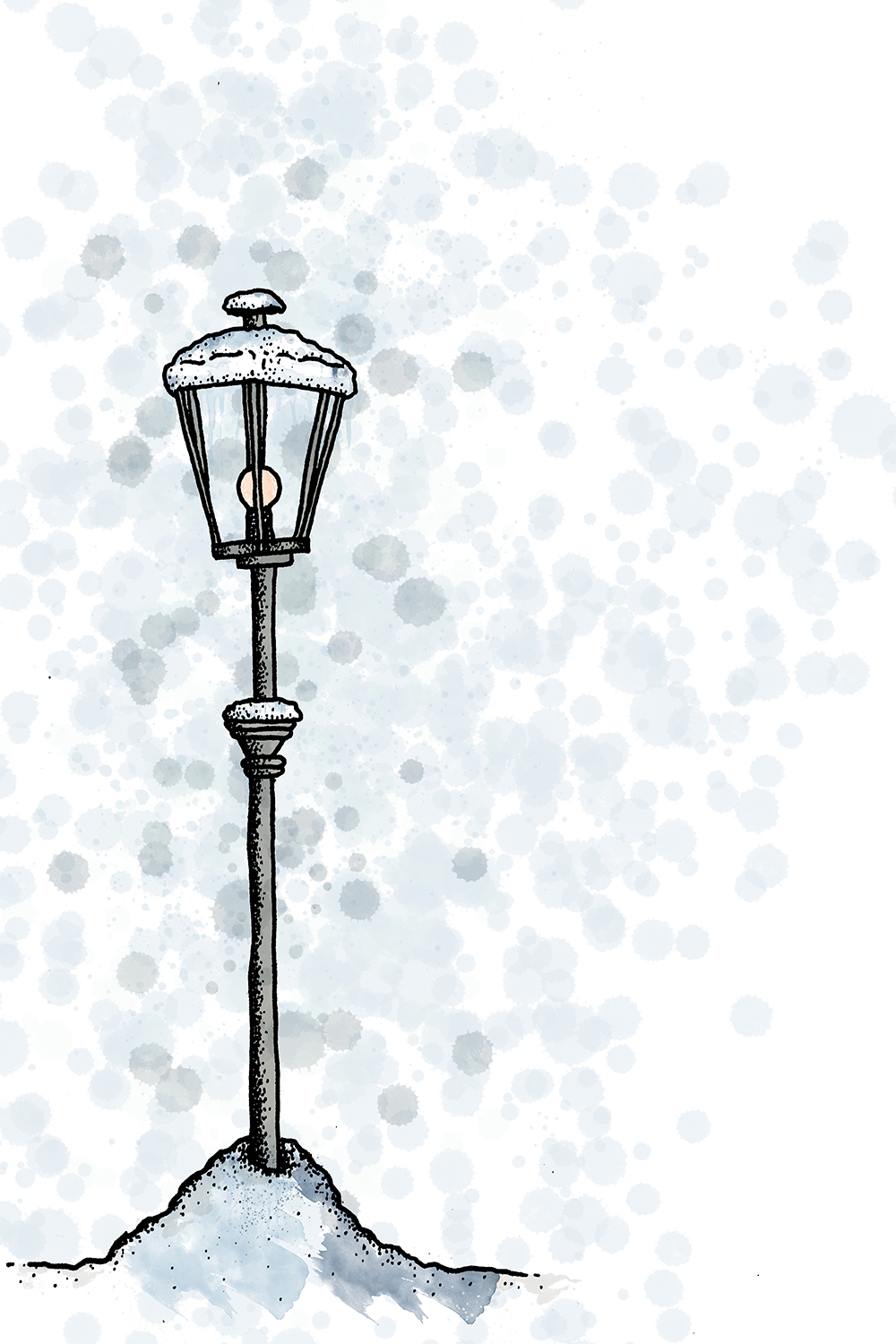 Schweigend wandern wir am Fluss entlang, durchqueren die Innenstadt, folgen der Elbe. Es ist dunkel, es ist Nacht, aber der Hafen schläft nie. Scheinwerfer durchschneiden die Schwärze, leuchten den Hafenarbeitern beim Beladen eines Containerschiffs. „AC“. Ist das der Name des Schiffes?
Schweigend wandern wir am Fluss entlang, durchqueren die Innenstadt, folgen der Elbe. Es ist dunkel, es ist Nacht, aber der Hafen schläft nie. Scheinwerfer durchschneiden die Schwärze, leuchten den Hafenarbeitern beim Beladen eines Containerschiffs. „AC“. Ist das der Name des Schiffes?
„Muss arbeiten …“, murmelt eine Stimme.
„Hast du das gehört?“, frage ich Dich.
„Was?“ Du siehst mich nicht einmal an. „Muss arbeiten …“
„Tyron?“, frage ich Dich. Es ist nicht oft, dass ich Dich bei Deinem Namen nenne. Weil Du ja doch nie daran erinnert werden willst, wer Du bist. Ob ich es weiß? Nicht wirklich.
„Muss arbeiten!“, sagst Du wieder. „Muss helfen! Muss etwas tun, muss handeln, muss mehr machen als gehen, Klavier spielen, beherrschen!“
Ein eiskaltes Zucken erfüllt mich bei der Erkenntnis, dass Dich dieses Wort tatsächlich ganz gut beschreibt: Du beherrschst mich. Beeinflusst mich in dem was ich tue. Flüsterst mir immer ins Ohr, was ich zu tun und zu lassen habe. Du beherrschst mich.
Du bist so zerbrechlich. Zumindest tust Du so, als ob, und gerade glaube ich es Dir sogar. Betrüge ich mich selbst indem ich mir einrede, dass Du jetzt dein wahres Gesicht zeigst und dass Du doch eigentlich ganz in Ordnung bist?
„Lass uns gehen!“ Ich rüttele an Deinem Arm, gebe Dir einen Schubs, doch es dauert, bis Du Dich in Bewegung setzt und immer wieder bleibst Du stehen.
Mehr als Gewohnheit
Im Sommer danach durchqueren wir die Antarktis, machen eine Bustour durch die Sahara und werden durch die Argentinier unten in Südamerika für ein paar Tage herzlich aufgenommen. In Australien werde ich von einer Schlange gebissen. Du gehst hinter mir und trittst mit einem Fuß auf das Schwanzende. Sie erschreckt sich und beißt das erste, was sich bewegt: meinen Fuß. So aufgeweckt und panisch habe ich Dich zuvor noch nie erlebt. Zuerst denkst Du, es sei eine Giftschlange, dabei ist sie harmlos und ungiftig. Dann sagst Du, dass es besser sei, dass sie mich gebissen hat und nicht Dich. Sonst wäre ich jetzt schließlich in großer Sorge. Du glaubst, dass der Biss nicht sehr weh tut. Um Dich zu beruhigen, verneine ich tatsächlich, schreie aber dafür in mich hinein. Ich fluche nur leise und wünsche mir doch, die Schlange hätte jemand ganz anderen gebissen. Du ziehst nur eine Augenbraue hoch.
In Neuseeland gibt es keine giftigen Tiere, also willst Du nach Neuseeland. Ich will es nicht, nicht jetzt, ich will nur nach Hause, aber Du redest mir ein, dass beim nächsten Mal ja Dir etwas passieren könnte und, dass ich das schließlich nicht will. Du überzeugst mich. Ich glaube, Dir tut es gut, Dich über mich zu stellen. Schon wieder könnte ich ja dafür verantwortlich sein, dass Dir etwas zustößt.
Blödes Gewissen.
Jetzt spielst Du also fehlerfrei. Aber unsere Unterhaltungen sind trotzdem nicht besser. Unterhaltungen. Nein, welch unzutreffendes Wort eigentlich. Unsere Wortwechsel. Wie ich mich dabei fühle? Gefangen. Gefangen in einer endlosen Schleife des surrealen Alltags. Ohne Abwechslung. Unsere Reisen scheinen nicht real, nur so, als hätte man mir Erinnerungen ins Hirn gepflanzt, die jemand anderes erlebt hat.
Aber ich weiß, dass Du mich brauchst, wenn Du auch nicht wirklich Fortschritte zu machen scheinst und ich auch nicht. Ich besuche Dich jeden Tag, aber meistens vergeht mir die Lust, musst Du wissen, und es scheint immer das gleiche zu sein. Ich möchte wissen, wie es sich für Dich anfühlt. Du, der Du wie hypnotisiert scheinst.
Wieder und wieder
„Wollen wir es heute wagen?“, frage ich Dich auch im nächsten Winter nahezu täglich und nicke in Richtung Eisdecke. Manchmal kämpft sich eine einsame Ente zu der von Menschenhand geschaffenen Insel in der Mitte.
„Wollen wir was wagen?“, fragst Du wieder. Immer hältst Du den Kopf gesenkt. Kein Wunder, dass Du mich nie verstehen kannst. Weshalb Du alles wieder vergisst, kann ich mir dennoch nicht erklären.
„Das Eis“, erkläre ich Dir. „Wollen wir über das Eis gehen? Einmal müssen wir es tun, bevor der Frühling kommt. Ein einziges Mal wenigstens.“
Wie immer nicke ich noch ein zweites Mal in Richtung des Eises. Die Schneedecke liegt inzwischen so hoch, dass sich die Enten ins Niemandsland zurückgezogen haben.
„Sieh, da sind sogar Fußspuren“, lüge ich wie eh und je.
„Fußspuren?“
Ich höre auf, mich über Dich zu ärgern.
„Sind die von dir?“
Ich schüttele den Kopf.
„Trotzdem. Wir könnten einbrechen und die Feuerwehr müsste uns retten oder nur du brichst ein und ich müsste dich retten. Dabei würde ich mich in Lebensgefahr begeben und das willst du doch nicht. Du willst sicher nicht verantwortlich sein, wenn mir etwas zustößt.“
„Okay“, sage ich. „Wir gehen weiter.“ Nie will ich mit Dir diskutieren. Kann es ja auch gar nicht. Weil Du kaum mal etwas sagst.
Als wir noch jung waren
Erinnerst Du Dich an früher? Als wir noch jung waren? Als wir noch in der Schule waren? Einmal, in einer Projektwoche, sind wir alle in die Stadt gegangen. Dort sollten wir uns eine Person aussuchen, sie beobachten und uns zu ihr eine Geschichte ausdenken. Du und ich, wir haben uns die gleiche Person ausgesucht. Und beinahe die gleiche Geschichte. Die Geschichte von einem engelsgleichen Wesen, das über die sich am Horizont aufwirbelnden Wolkentürme glitt und über alle Menschen zu wachen schien.
„Was hast du dir denn ausgesucht?“, fragte man mich zuerst und ich las meinen Text vor und bemerkte erst dann den Blick, den Du mir zuwarfst.
„Verräterin“, formten Deine Lippen.
Ich wollte mit den Schultern zucken, wollte cool sein. Aber stattdessen verstummte ich. Sah Dich nur an. Sah in die Leere und alle fragten sich, wo ich denn hinschaute, aber nur ich wusste es ganz genau, außer Du, Du wusstest es sogar noch besser als ich.
„Es tut mir Leid“, flüsterte ich irgendwann und alle starrten mich an, verstanden nicht, was mir leid tat und mit wem ich redete.
„Entschuldige dich nicht“, hast Du von mir verlangt und da war ich das erste Mal durcheinander und aufgewirbelt und leer und habe nicht verstanden, worum es ging und was passierte. Weshalb Du mich so angeherrscht hast, dass ich schweigen soll und warum Du so wütend auf mich warst. Ich habe nicht gewusst, ob auch ich einfach nur wütend auf mich selbst war oder ob mehr dahintersteckte, hinter meinen Gefühlen.
Alles auf Anfang
Als ich den Raum der Stille in Hamburg, unserem Hamburg an der Alster in unserer Bar betrete, verstummen Deine Klaviertöne. Du drehst Dich zu mir um.
„Wie heißt das Stück?“, frage ich aus reiner Gewohnheit noch einmal.
„Prélude. Von Rachmaninov“, antwortest Du. „Aber das tut doch nichts zur Sache.“
Ich hebe eine Augenbraue und sehe Dich zweifelnd an. Erwache ich aus einem Traum?
„Ich bin heute über das Eis gegangen.“
 Erst jetzt merke ich, dass Deine Sachen vor Nässe triefen. Unter dem Klavier hat sich bereits eine Pfütze gebildet. Deine Lippen scheinen blau und Du zitterst, während Du sprichst. Aber Du strahlst, wie ich Dich noch nie habe strahlen sehen.
Erst jetzt merke ich, dass Deine Sachen vor Nässe triefen. Unter dem Klavier hat sich bereits eine Pfütze gebildet. Deine Lippen scheinen blau und Du zitterst, während Du sprichst. Aber Du strahlst, wie ich Dich noch nie habe strahlen sehen.
Ich habe immer gewusst, dass Du unsterblich sein würdest.
Herzliche Grüße
Deine Amalia




